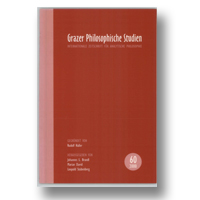|
articles |
|
1.
|
Grazer Philosophische Studien:
Volume >
47
Roger Schmit
Über Bolzanos Begriff der Auslegung
abstract |
view |
rights & permissions
| cited by
In der Wissenschaftslehre Bolzanos (1837) spielt der Begriff der Auslegung eine nicht unwesentliche Rolle. Seine Hauptfunktion besteht in der Explikation der logischen Elemente im Satz und in der Reduktion der sprachlichen Sätze auf das Grundmuster ,,A hat b". Die Herausbildung und die Behandlung der Auslegungsproblematik bei Bolzano sind stark vom neuzeitlichen Gedankengut, aber auch von der mittelalterlichen Philosophie und Logik beeinflußt. Obwohl sein Auslegungsbegriff der logischen Tradition weitgehend verpflichtet bleibt, weist er doch andererseits tiefgehende Parallelen mit der von Frege und Wittgenstein entwickelten Methode der logischen Analyse auf, sodaß Bolzano auch in diesem Punkt als ein Vorläufer der analytischen Philosophie gelten kann.
|
|
|
|
|
2.
|
Grazer Philosophische Studien:
Volume >
47
Philip Hugly, Charles Sayward
The Internal/External Question
view |
rights & permissions
| cited by
|
|
|
|
|
3.
|
Grazer Philosophische Studien:
Volume >
47
Jesús Padilla Galvez
Gödels Vorschlag für die Behandlung selbstbezüglicher Sätze
abstract |
view |
rights & permissions
| cited by
Welches ist das adäquate System für die Beweisbarkeit in formalisierbaren mathematischen Theorien? Um diese Frage zu beantworten, werden Gödels UnvoUständigkeitsbeweis und vor allem dessen Strukturen analysiert, die ihn als zu einer besonderen Gruppe innerhalb der selbstbezüglichen Sätze gehörig ausweisen. Weiters wird der Interpretationsstreit zwischen L. Wittgenstein und K. Gödel rekonstruiert und zuletzt eine Reihe semantischer Folgemngen aus Gödels Lösungsvorschlag gezogen.
|
|
|
|
|
4.
|
Grazer Philosophische Studien:
Volume >
47
Uwe Meixner
Parmenides und die Logik der Existenz
abstract |
view |
rights & permissions
| cited by
Es wird gezeigt, daß sich Parmenides' Argument gegen Veränderung und Vielheit aus den Fragmenten seines Lehrgedichts so rekonstruieren läßt, daß es entweder formal korrekt wird, oder aber seine Prämisse ,,Seiendes ist, Nichtseiendes ist nicht" evidentermaßen richtig ist. Beides zugleich ist nicht zu haben. Es wird plausibel gemacht, daß die Rekonstruktionen in Parmenides' Sinn sind. Betrachtet man sein Argument als formal korrekt, so stellt es, wenn wir das Zeugnis der Erfahrung akzeptieren, eine redactio ad absurdum der auch heute noch vielfach vertretenen Position des Aktualismus „Es gibt nur Aktuales" dar. Parmenides freilich faßte es im Gegenteil als reductio ad absurdum der kognitiven Relevanz der Erfahmng auf.
|
|
|
|
|
5.
|
Grazer Philosophische Studien:
Volume >
47
Dirk Greimann
Freges These der Undefinierbarkeit von Wahrheit:
Eine Rekonstruktion ihres Inhalts und ihrer Begründung
abstract |
view |
rights & permissions
| cited by
Der erste Teil des Aufsatzes untersucht den Inhalt der These. Im Zentrum steht dabei die Frage, was Frege unter ,,Wahrheit" versteht. Das Ergebnis der Untersuchung ist, daß Freges Undefinierbarkeitsthese (entgegen der üblichen Auffassung) sich nicht auf den „Inhalt des Wortes ,wahr'" (bzw. auf das Wahrheitsprädikat) bezieht, sondern auf „die Wahrheit, deren Anerkennung in der Form des Behauptungssatzes liegt" (bzw. auf den Urteilsstrich. Das Kernstück des zweiten Teils der Arbeit ist eine Rekonstruktion der Argumente Freges für die These in drei Versionen. Für die Rekonstruktion wird nicht (wie sonst üblich) Freges Redundanztheorie der Wahrheit herangezogen, sondern seine Urteilstheorie. Im dritten Teil schließlich wird die Frage behandelt, ob Freges These durch Tarskis Wahrheitsdefinitionen widerlegt ist.
|
|
|
|
|
6.
|
Grazer Philosophische Studien:
Volume >
47
Martin Anduschus
Motivation, Entwicklung und Untergang von Russells Multiple-Relationen-Therorie des Urteilens
abstract |
view |
rights & permissions
| cited by
In der vorliegenden Arbeit werden Russells Motivation für die Multiple-Relationen-Theorie des Urteilens, die Entwicklung dieser Theorie und die Gründe für ihren Untergang untersucht. Auf alle drei Phasen ergibt sich eine neue Perspektive. Wittgensteins berühmt-berüchtigte Kritik an Russells Theorie wird diskutiert, eine neue Interpretation dieser Kritik vorgelegt und schließlich wird der meistens vernachlässigte Zusammenhang zwischen dieser Theorie und Russells früher Semantik beleuchtet, insbesondere seiner Theorie der Prädikation.
|
|
|
|
|
7.
|
Grazer Philosophische Studien:
Volume >
47
Stephen J. Sullivan, L. Gregory Wheeless
Goldman's Early Causal Theory of Knowledge
abstract |
view |
rights & permissions
| cited by
In his 1967 paper 'A Causal Theory of Knowing', Alvin Goldman sketched an account of empirical knowledge in terms of appropriate causal connections between the fact known and the knower's belief in that fact. This early causal account has been much criticized, even by Goldman himself in later years. We argue that the theory is much more defensible than either he or its other critics have recognized, that there are plausible internal and external resources available to it which save it from many objections in the literature (in particular, objections raised by Harman, Pappas and Swain, Klein, Dretske, Goldman, Shope, Ackermann, Morawetz, and Collier).
|
|
|
|
|
8.
|
Grazer Philosophische Studien:
Volume >
47
Myian Engel, Jr.
Coarsening Brand on Events, while Proliferating Davidsonian Events
abstract |
view |
rights & permissions
| cited by
A course-grained theory of event individuation is defended by arguing that events are spatiotemporal particulars with an ontological affinity to coarse-grained physical objects and by demonstrating that the metalinguistic correlate to one set of adequate identity conditions for events is most plausibly iterpreted as coarsely individuating events. Such coarse-grained events, it is argued, do admit of divisibility proliferation, much like the proliferation of physical objects entailed by Goodman's calculus of individuals. This coase-grained, divisibility proliferation account of events is then used to resolve Davidson's paradox concerning the poisoned space traveller who is killed long befor he dies.
|
|
|
|
|
9.
|
Grazer Philosophische Studien:
Volume >
47
Robert M. Harnish
What is the Sense of Phos and Hes?:
Kaplan's Corrected Fregean Theory of Demonstratives
abstract |
view |
rights & permissions
| cited by
Frege's puzzle for demonstratives is accounting for the cognitive significance of identity statements containing demonstratives, such as "That [demonstration-1] is identical to that [demonstration-2]". Since the demonstrative 'that' makes the same semantic contribution (has the same 'character') on both occurrences, the difference must be due to the cognitive significance or 'senses' of the associated demonstrations. But what is the sense of a demonstration? Kaplan's suggested solutions in terms of gestures and appearances are not compatible with his general theory, and do not work - a different solution must be found.
|
|
|
|
|
10.
|
Grazer Philosophische Studien:
Volume >
47
Francesco Orilia
The Eightfold Ambiguity of Oratia Obliqua Sentences
abstract |
view |
rights & permissions
| cited by
Sentences such as "Holmes believes that the leader of the London gang is about to be incriminated" are commonly understood to have two readings: de re and de diclo. On the basis of the way which the de relde dicto distinction is customarily conveyed, it is shown that such sentences have not just two but eight readings. It is suggested that intensional entities - such as senses, guises or denoting concepts - are the most natural way to account for this variety of readings.
|
|
|
|
|
11.
|
Grazer Philosophische Studien:
Volume >
47
Ishtiyaque Haji
Consequential Omnibenevolence
abstract |
view |
rights & permissions
| cited by
It is argued that a theorist like Leibniz who believes that a consequentially omnibenevolent God created the actual world must presuppose that there is a best possible world. If so, then if God did create this world, there is no best, and He has as essential properties each of His perfections, God's omnibenevolence must be understood in terms of some alternative concept of omnibenevolence. Such an alternative is offered, one consistent with there being no best world, and one that does not presuppose the truth of the consequentialist moral principle that one ought to do the best one can.
|
|
|
|
|
review article |
|
12.
|
Grazer Philosophische Studien:
Volume >
47
W. Pogge
Kants Begründung der praktischen Philosophie
view |
rights & permissions
| cited by
|
|
|
|